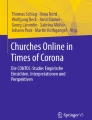Zusammenfassung
Dieser Artikel basiert auf qualitativen Interviews mit 34 Kindern im Alter von 6 bis 16 Jahren, die in Deutschland und Ghana leben und verschiedenen religiösen Gruppen angehören oder sich als Atheist:innen identifizieren. Aus einer konstruktivistischen Perspektive, die Kinder als (religiöse) Akteur:innen in ihren Lebenswelten betrachtet, wird analysiert, wie sie die COVID-19-Pandemie und die öffentlichen Schutzmaßnahmen im Hinblick auf religiöse und säkulare Deutungsmuster interpretieren und wie sie diese Interpretationen mit der Nutzung religiöser und gesundheitlicher Praktiken als Bewältigungsstrategien in der Pandemie verknüpfen.
Abstract
This article is based on qualitative interviews with 34 children aged 6 to 16, who live in Germany and Ghana and belong to different religious groups or identify as atheists. Drawing on a constructivist perspective that regards children as (religious) actors in their lifeworlds, it is analyzed how they interpret the COVID-19 pandemic and public mitigation measures with reference to religious and secular meaning patterns, and how they relate these interpretations to their use of religious and public health practices as ways to cope with the pandemic.
Similar content being viewed by others
Avoid common mistakes on your manuscript.
1 Einleitung
Kinder wachsen heute in einer Zeit „multipler Krisen“ auf (Gärtner 2020, S. 10). Sie sind von Katastrophen wie Krieg, Klimawandel oder der COVID-19-Pandemie direkt betroffen, werden oft aber lediglich als Anhängsel ihrer Familien mitgedacht. Zumeist werden sie hierbei in ihrer Vulnerabilität gesehen, nicht aber in ihrer „VulnerAbility“ (Konz 2022, S. 56 ff.) – einer Handlungsfähigkeit unter widrigen Lebensumständen. Dementsprechend wurde dem Wohlergehen von Kindern in der Pandemie bislang eine eher geringe Bedeutung eingeräumt. Ebenso wenig wurde die Agency von Kindern in den Blick genommen im Sinne einer Fähigkeit, das Geschehen in ihren Lebenswelten im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzugestalten, an der Gesellschaft teilzuhaben und Verantwortung für die Gesellschaft im Pandemiegeschehen zu übernehmen (Corsaro 1996; Honig 2009; Mayall 2001).
Anders als bei Fridays for Future oder der Black Lives Matter Bewegung haben sich Kinder kaum auf nationaler oder internationaler Ebene als Kollektiv organisiert, um ihre Beteiligung an der Aushandlung von Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie oder der Bewältigung ihrer Folgen einzufordern. Ursächlich dafür mag sein, dass Kinder keine homogene Gruppe bilden, sondern in unterschiedlichen sozialen, ökonomischen, kulturellen, religiösen oder infrastrukturellen Kontexten leben, die in und nach der Pandemie als Dimensionen sozialer Ungleichheit stark zum Tragen kommen und sich auf ihr Handeln auswirken.
Da Krisen, wie die COVID-19-Pandemie nicht „an Ländergrenzen halt“ machen, können sie nur global überwunden werden (Gärtner 2020, S. 11). In der COVID-19-Pandemie gab es Zusammenarbeit vor allem im medizinischen Sektor, die Eindämmungsmaßnahmen waren und sind jedoch stark national fragmentiert und die Ressourcen zur Bewältigung der Krise äußerst ungleich verteilt, was sich allerdings nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Ländern zeigte. Aus diesem Grund nimmt der Beitrag eine binationale Perspektive ein und untersucht die Wahrnehmung von Kindern bezüglich des Pandemiegeschehens. Die Auswahl der Untersuchungsländer erfolgte dabei zunächst pragmatisch und war zum einen begründet in der langjährigen Zusammenarbeit von World Vision Ghana und World Vision Deutschland als und zum anderen einer gewissen Vergleichbarkeit an religiösen Zugehörigkeiten in der Bevölkerung. Vor der Pandemie bereits geplant als Untersuchung zum Umgang von Kindern mit religiöser Diversität in ihren Lebenswelten, bot die 2020 erhobene 5. World Vision KinderstudieFootnote 1 die Möglichkeit, zu untersuchen, wie Kinder in zwei Ländern mit besonders harten, sie betreffenden Eindämmungsmaßnahmen diese Veränderungen in ihrer Lebenswelt deuten und welche religiösen Bezüge in diesen Deutungen zum Vorschein kommen.Footnote 2
Zahlreiche, zumeist auf Erwachsene bezogene Untersuchungen belegen, dass Religiosität ein Copingfaktor bei der Bewältigung einschneidender Lebensereignisse sein kann (Zwingmann und Klein 2020, S. 38–55), auch wenn religiöses Coping als „ambivalentes und multidimensionales Phänomen“ verstanden werden muss (Haußmann 2019, S. 484) und im Wechselverhältnis „abhängig von den Lebensvollzügen, religiösen und lebensgeschichtlichen Erfahrungen sowie systemischen Zusammenhängen“ ist (Haußmann 2019, S. 487). Der Begriff des religiösen Copings beschreibt „die Funktion von Religion angesichts von Sinnkrisen und existentiellen Erschütterungen im menschlichen Leben“ (Ritter et al. 2006, S. 193), meint jedoch nicht, dass am Ende der Krisensituation „das Ergebnis eines gereiften Glaubens stehen [muss], der Schwierigkeiten integrieren kann“ (Haußmann 2019, S. 489). Im Folgenden soll nach Deutungen und „Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Praxis von Religion gefragt“ werden (Ritter et al. 2006, S. 194), die – neben weltlichen Deutungen – auch Kindern in der Pandemie zur Verfügung stehen. Da Einrichtungen und Institutionen der Kindheit über lange Phasen der Pandemie geschlossen waren und Bedarfen von Kindern nur unzureichend nachkommen konnten, musste die Bewältigung der Pandemie vor allem auf individueller, familiärer oder freundschaftsbezogener Ebene ablaufen. Wie der Aufsatz zeigt, kann Religion für Kinder in beiden Ländern eine Ressource der Krisenbewältigung darstellen, auf die sie im Sinne einer Agency selbstgesteuert zurückgreifen und die sie auch in Freundschaftsbeziehungen teilen können, steht dabei aber nicht in Konkurrenz zu weltlichen Deutungen. Die Auswahl der Untersuchungsländer und Darstellung der weitestgehend länderübergreifenden Ergebnisse ist daher nicht auf einen binären und dichotomen Kontrast angelegt, sondern zeigt zwei Länderbeispiele, die durch die Schulschließungen ähnliche Grundbedingungen für Kinder schafften, mit denen sie in Rückgriff auf kontextspezifische und individuelle Strategien ihrer VulnerAbility umzugehen versuchten.
2 Religiosität als Agency in kindheitstheoretischer Perspektive
Da in Deutschland und Ghana unterschiedliche Altersspannen und Übergänge für die Entwicklung von der Kindheit über die Jugend zum Erwachsenenalter gegeben sind und diese zudem hochgradig individuell sind, verwende ich in diesem Artikel einen rechtlich begründeten Begriff der Kindheit. Entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention, die beide Untersuchungsländer ratifiziert haben, ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Alle interviewten Kinder besuchten zum Zeitpunkt der Pandemie noch die Schule und waren als Kinder gleichermaßen von den Schulschließungen betroffen.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der biografischen und sozialen Phase der Kindheit hat in westlichen Ländern in den letzten 30 Jahren eine entscheidende Entwicklung durchlaufen: Während Kinder bis in die 1980er-Jahre als eher passiv Lernende einer ‚Erwachsenenkultur‘ wahrgenommen wurden, verlagerte sich der Fokus in den 1990er-Jahren darauf, welchen Beitrag Kinder als soziale Akteur:innen zur Gestaltung der Gesellschaft leisten (Corsaro 1996; Honig 2009; Mayall 2001) und wie sie ihre „eigene[n] Interessen und Bedürfnisse in ihren Entscheidungen, im Handeln zum Ausdruck bringen“ (Wihstutz 2019, S. 28). Die konstruktivistische Perspektive auf Kindheit untersucht, wie Kindsein im Alltag durch bestimmte Praktiken und Routinen erfahrbar wird (vgl. James und Prout 1990; James, Jenks und Prout 1998), die typischerweise in Interviews oder teilnehmenden Beobachtungen mit Kindern erhoben werden. Hierbei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch moderne Kindheitsforschung oft von hegemonialen Deutungsstrukturen durchdrungen ist, die die Entwicklung von Kindern außerhalb der ‚westlichen Welt‘ tendenziell als defizitär wahrnimmt (Oppong 2015, S. 28; auch Matsumoto und Juang 2004, S. 172) und damit das Risiko birgt, diese Wahrnehmung durch ein bestimmtes methodisches Design zu reifizieren. In Anlehnung an Teo (2008, S. 57) kann von „epistemologischer Gewalt“ gesprochen werden, wenn in westlichen Kontexten entwickelte Konzepte und Annahmen unreflektiert übertragen werden. Die Interpretation erhobener Daten konstituiert diese Kinder als ‚Andere‘, die eine gesetzte Norm nicht erfüllen. Dagegen muss kritisch hinterfragt werden, ob eine wissenschaftliche „westernization of childhood“ (vgl. Bühler-Niederberger 2011) bestimmte Konstruktionen von Kindheit ausblendet, die für Kindheitskonstruktionen in Ghana relevant sein können. Dies betrifft auch die Themenstellungen von Kindheitsstudien, die Kindheit besonders in afrikanischen Kontexten im Hinblick auf Armut, Krankheiten, Konflikte oder Kinderarbeit problematisieren (Imoh 2016, S. 456–457). Entsprechend eines hegemonialen Kindheitsverständnisses sind außerdem Lebensbereiche wie Lernen, Spielen und Freizeit, die in Studien zu westlichen Gesellschaften als wichtige Sozialräume und Beziehungsstrukturen der Selbstbestimmung und Gestaltung von Kindern gelten, für viele afrikanische Länder untererforscht. Beide Perspektiven vernachlässigen dabei die Pluralität von Lebenslagen innerhalb nationaler und regionaler Kontexte und lassen außer Acht, dass auch Kinder in hochgradig vulnerablen Situationen handlungsfähige Akteur:innen ihrer Lebenswelten sein können. Die vorliegende Untersuchung fragt deshalb, welchen religiösen und weltanschaulichen Deutungsmustern Kinder in beiden Kontexten Bedeutung zuschreiben und auf welche Ressourcen sie zurückgreifen, um die Pandemie zu bewältigen.
Damit soll auch der in der Kindheitsforschung formulierten Forderung Rechnung getragen werden, Kindheit außerhalb des Westens nicht nur mit einem Fokus auf schwierige Lebensumstände und Mangelsituationen zu betrachten (Twum-Danso Imoh 2016, S. 456) und Bilder eines benachteiligten ‚Globalen Südens‘ zu reproduzieren, sondern die Agency von Kindern in unterschiedlichen Kontexten in den Blick zu nehmen. Theoretisch ist dies durch den „Capability Approach“ beeinflusst (Andresen, Hurrelmann und Fegter 2010; Fegter und Richter 2013), der „Fähigkeiten und Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Handeln“ (Andresen und Neumann 2018, S. 43) von Kindern ermittelt, die sich innerhalb wichtiger Sozialbeziehungen zu Eltern sowie Freund:innen entwickeln und gerahmt werden durch formelle und informelle Institutionen in der Schule und Freizeit (ebd. 44). Innerhalb von Institutionen und Beziehungsstrukturen werden Deutungsangebote erlernt, die im Sinne eines „tragenden Sinnhorizontes“ (Simojoki 2017, S. 31) bei der Verarbeitung von Krisen und Umbrüchen helfen können. Basierend auf Schütz (1981) handelt es sich nach Arnold (1985, S. 23) bei Deutungsmustern um in der Sozialisation vermittelte oder über eigene lebensgeschichtliche Erfahrungen erworbene „Situations‑, Beziehungs- und Selbstdefinitionen“, die ein „Orientierungs- und Rechtfertigungspotential von Alltagswissensbeständen“ bieten und somit die Handlungsfähigkeit von Individuen herstellen. Bestandteil dieser Deutungen können für Kinder auch „religiöse Heimaten“ sein, die spezifische religions-, sprach- und kulturimmanente Deutungen bereitstellen, auf die sich glaubende Kinder beziehen, um ihren Erlebnissen Sinn zu verleihen (vgl. Konz 2022, S. 56 mit Bezug auf Szagun 2014). Religionszugehörigkeit und individueller Glaube sind somit Resilienzressourcen, die kontextabhängig und entwicklungsspezifisch verstanden werden müssen. Religiosität ist immer auch in soziale Gemeinschaften und/oder den Familienhabitus eingebunden. In der Sozialisation von Kindern in Ghana spielen beispielsweise kollektivistische Werte eine größere Rolle als in ‚westlichen Gesellschaften‘ (vgl. dazu Hosny et al. 2020, S. 3524). Dies kann sich in Bezug auf religiöse Deutungen und Praktiken zeigen. Trotzdem darf auch Kindern in Ghana ihre individuelle Religiosität nicht abgesprochen werden. Wie Kinder in Deutschland sind sie „produktive, schöpferische Akteur(*innen)“, die „vorgegebene Weltdeutungen, gebrochen durch eigene Erfahrungen, immer auch modifizier[en] und umdeute[n].“ (Herma 2009, S. 103).
3 Methodik und Datenmaterial
Das Datenmaterial basiert auf qualitativen Interviews, die im Rahmen der fünften World Vision Kinderstudie durchgeführt wurden. Die aktuelle „World Vision Kinderstudie“ (2020–2023) ist erstmals als binationale Untersuchung angelegt und erweitert den Blick über Deutschland hinaus auf Ghana als wichtigem World Vision Partnerland. Ursprünglich sollte in dieser Kinderstudie die religiöse und weltanschauliche Diversität in den Lebenswelten von Kindern in Deutschland und Ghana fokussiert werden. Im Frühjahr 2020 wurde jedoch offensichtlich, dass jede damalige Forschung unumgänglich mit der COVID-19-Pandemie konfrontiert war, weswegen die Perspektive der Kinder auf die Pandemie in den Interviewleitfaden aufgenommen wurde.
3.1 Die Datenerhebung
Sämtliche Arbeitsschritte des Forschungsprozesses wurden in gleichberechtigter Kooperation eines Forschungsteams in Ghana und Deutschland durchgeführt. Hierbei wurde gemeinsam ein Interviewleitfaden entwickelt, der nach einem Pretest in beiden Ländern für die Haupterhebung vor allem im Hinblick auf die Eingaben der Kinder modifiziert wurde. Schwerpunkt dieses Leitfadens war nicht die evaluative Bewertung der Wertestrukturen interviewter Kinder, sondern eine Analyse ihrer Deutungen und Werte in Auseinandersetzung mit ihren spezifischen lebensweltlichen Herausforderungen. Der bedeutungsgleiche Interviewleitfaden beider Länder umfasste episodisch-narrative, begrifflich-semantische sowie projektive Fragen, um das Forschungsthema möglichst umfassend und multiperspektivisch zu explorieren. Zudem wurde Stimulusmaterial erstellt, welches den Kindern während des Interviews als Unterstützung dienen sollte, damit sie ihre Gedanken und Gefühle formulieren können. Für den Fragekomplex zur COVID-19-Pandemie wurden außerdem Bildkarten genutzt, die mithilfe von ‚Emojis‘ unterschiedliche Emotionen und Tätigkeiten zur Strukturierung des Tagesablaufs darstellten. Sie dienten hierbei der Stimulierung von Narrativen, also sinnstiftenden Äußerungen oder Erzählungen, die als Textdaten ausgewertet wurden. In Bezug auf Religion und Glaube wurden die Kinder unter anderem gebeten, Kärtchen mit unterschiedlichen Werten nach ihrer persönlichen Bedeutung zu sortieren, ihre Wahl zu erläutern und über ihren eigenen Glauben und Glaubenspraktiken sowie in der Familie und ihren Freundschaften zu berichten. Die in diesem Aufsatz vorliegenden Daten stammen zu einem nennenswerten Teil aus Fragen nach Anlässen ritualisierter und freier Gebete.
Die Erhebung der Daten war mit der Problematik konfrontiert, dass schon vorab entschieden wurde, Kinder zu Religion und Diversität zu befragen – sie haben diese Themen also nicht eigenständig in Interviews zur Pandemie eingebracht. Allerdings wurden religiöse Fragen und pandemiebezogene Fragen in zwei verschiedenen Frageblöcken behandelt, so dass Kinder selbst entscheiden mussten, ob sie diese Themen in Verbindung bringen. Einige glaubende Kinder taten dies sehr intensiv, indem sie beispielsweise die Pandemie als Gebetsanlass benannten oder religiöse Deutungen bei Fragen zur Entstehung der Pandemie äußerten. Andere (auch glaubende) Kinder hingegen stellten kaum Verbindungen zwischen Religion und Pandemieerleben her oder wiesen religiöse Bezüge sogar zurück, was ebenfalls für diesen Aufsatz ausgewertet wurde.
3.2 Die Datenauswertung
In Anlehnung an Schütz’ Begriff der Lebenswelt kann man die Deutungen der Kinder zur Pandemie verstehen als „Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes“ (Schütz 1981, S. 112). Hierbei greifen sie entweder auf individuelle Deutungsmuster zurück, die sie innerhalb ihrer eigenen Erfahrungsgeschichte erworben haben, oder auf kollektive Deutungsmuster, die sie im Laufe der „Sozialisation, Kulturation und Personalisation“ (Kraus 2006, S. 3) als Wissensvorrat aufgebaut haben. Somit kann über das Konzept der Deutungsmuster die Einbettung, Reproduktion und Modifizierung kollektiver Sinnzusammenhänge in individuelle Äußerungen untersucht werden, die über die subjektive Sinngebung der Akteur:innen hinausgeht (in Anlehnung an Sachweh 2009, S. 76). Feststellbar ist dies in den Daten, wenn bestimmte Deutungen nicht nur in einem Interview aufzufinden sind, sondern von mehreren Kindern im Hinblick auf semantische oder inhaltlich-argumentative Ähnlichkeiten geteilt werden. Nach Ullrich liegt ein kollektiv geteiltes Deutungsmuster dann vor, wenn in Narrativen mehrerer Individuen „typische d. h. mehrfach vorzufindende und konsistente (sinnhafte) Begründungen und Situationsdefinitionen erkennbar sind“ (Ullrich 1999, S. 443).
Für die Analyse der Deutungsmuster wurden die Interviewtranskripte zunächst entsprechend der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz codiert. Hierbei wurden deduktiv gewonnene Hauptkategorien mit einer hermeneutisch-interpretativen Vorgehensweise induktiv erweitert (vgl. Kuckartz 2012, S. 51, 2018, S. 47), welche aus Platzgründen in diesem Aufsatz nicht dargestellt wird. Parallel zur Interpretation erfolgte ein ergänzendes prozessbegleitendes Reflektieren der Erhebungs- und Auswertungsprozesse mit „theoretischen Memos“ (Kuckartz 2010, S. 133 ff.; Corbin und Strauss 2008), um die deskriptive Argumentation zu verdichten und Versuche einer Theoretisierung bzw. Theorieerweiterung zu ermöglichen (vgl. Kuckartz 2010, S. 135). Die induktiv-deduktive Vorgehensweise ist in diesem Aufsatz stark verknappt dargestellt, indem wichtige Datenstücke zur Illustration identifizierter Deutungsmuster angeführt und mit der Forschungsliteratur im Abgleich diskutiert werden.
3.3 Sample
Die Datenerhebung der qualitativen Teilstudie fand zwischen Juni und September 2020 in Deutschland und Ghana mit jeweils 15 Interviews von sechs- bis sechzehnjährigen Kindern statt. Hierbei wurde explizit darauf geachtet, bereits vor der Erhebung ein kontrastierendes Sample auszuwählen, das im Hinblick auf die Kategorien Alter, Religionszugehörigkeit/Atheismus, Siedlungsgebiet- und Struktur, ethnische Zugehörigkeit und sozio-ökonomische Schicht divers ist, um möglichst unterschiedliche Narrative und Konstruktionen von Kindern zu erhalten. Über die Regionen beider Länder verteilt wurden verschiedene Großstädte sowie auch ländliche Gebiete ausgewählt, in denen Interviews geführt wurden. In Deutschland wurde in den Städten Bremen, Berlin, Leipzig, Köln, München, Frankfurt am Main und umliegenden ländlichen Gebieten erhoben. In Ghana wurde in den Städten Accra, Cape Coast, Tamale, Bolgatanga, Hohoe und umliegenden ländlichen Gebieten erhoben. Das Sample umfasste darüber hinaus unterschiedliche ethnische Gruppen. In Deutschland bestand bei sieben Fällen ein Migrationshintergrund (türkisch, polnisch, griechisch, italienisch, pakistanisch). Diese Kinder wurden ihrer Sprachfähigkeit entsprechend auf Deutsch interviewt. Kinder, die in Ghana interviewt wurden, gehören den ethnischen Gruppen Ga, Akan, Kasin, Ewe, Gurma, Ga-Adangbe und Mole Dagbani an. Interviews wurden in den Sprachen Englisch, Ewe, Fante, Ga und Gurma geführt. Hauptsächlich wurde während der Interviews Englisch gesprochen, vereinzelt wechselten Kinder aber in eine andere Sprache, um zusätzliche Erklärungen zu geben. Auch hier war aber die hauptsächliche Interviewsprache Englisch, so dass für die Dateninterpretation nur eine sehr geringe Datenmenge übersetzt werden musste.
Die in Deutschland interviewten Kinder bezeichneten sich als römisch-katholisch, evangelisch, muslimisch, freikirchlich, jüdisch, griechisch-orthodox oder atheistisch. Die in Ghana interviewten Kinder bezeichneten sich als katholisch, evangelikal, freikirchlich, protestantisch, charismatisch, pentekostal, muslimisch oder einem traditionellen Glauben angehörend. Atheistische Kinder konnten wir hier nicht für ein Interview gewinnen, was mit der geringen Verbreitung und der Stigmatisierung des Atheismus in Ghana im Zusammenhang stehen kann.
Zum Interviewzeitpunkt befanden sich die meisten Kinder noch in der Phase der Schulschließungen. In Ghana waren wenige Kinder ausschließlich für Prüfungen in die Schulen gekommen, in Deutschland fand in sehr geringem Umfang Wechselunterricht statt. Die Interviews erfolgten bei den Kindern zu Hause, oft draußen, und dauerten zwischen einer und eineinhalb Stunden. In vier Fällen wurden Geschwisterpaare interviewt. Bis auf ein Kind, das sich explizit die Anwesenheit der Mutter während des Interviews gewünscht hatte, wurden die Interviews mit den Kindern allein durchgeführt. Abhängig von der Region wurden zu dieser Zeit geltende Hygiene- und Kontaktregeln während der Interviews grundsätzlich eingehalten.
Zum Zwecke der Anonymisierung wurden die Kinder gebeten, sich einen Vornamen auszusuchen, unter dem sie zitiert werden wollen. Viele Kinder in Ghana wählten Akronyme (wie z. B. QZN), die sich entweder aus Initialen mehrerer Vornamen zusammensetzen oder eine Umschrift von Namen ihrer jeweiligen Sprache sind. Die direkten Zitate der Kinder werden in diesem Aufsatz in Originalsprache dargestellt; d. h. deutsche Zitate stammen aus in Deutschland geführten Interviews und englische Zitate aus in Ghana geführten Interviews.
4 Haltungen zum COVID-19-Virus und seinen Eindämmungsmaßnahmen
Die Pandemie erleben Kinder des Samples als bedeutsamen Einschnitt in ihrem Leben, der Angst auslöst und von ihnen ein verantwortungsbewusstes Handeln erfordert. Natürlich können folgende Ergebnisse zufällige Resultate des Samplings sein, sie sind zunächst aber als gemeinsam geteilte Haltungen von Kindern in Ghana und Deutschland zur Pandemie feststellbar, die aus sozioökonomisch sehr divergenten Kontexten stammen – innerhalb und zwischen den Untersuchungsländern. Obwohl beim Sampling nur demographische Kriterien, aber keine Haltungen zur Pandemie abgefragt wurden, messen die Kinder als geteilte Haltung den Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie wie Masken, Händehygiene und Kontaktbeschränkungen große Bedeutung bei. Sie verfügen über ein hohes biologisches und medizinisches Wissen über das COVID-19-Virus und seine Verbreitungswege sowie Krankheitssymptome und nennen konkrete Möglichkeiten, sich vor einer Ansteckung zu schützen.
„(Es heißt nicht) Corona-Virus, sondern COVID-19. Und davor gab es das SARS-Virus. Und das ist sehr ansteckend. Ich weiß auch, was die Verluste sind: Schnupfen, Husten und Fieber“ (Benny, m, 9 Jahre, atheistisch).
“Is a deadly disease and then some of the symptoms are cough, difficult in breathing, sneezing, sore throat. And then if you want to prevent yourself, you have to wash your hands with soap under running water for at least twenty seconds and use an alcohol-based hand sanitizer not below 70 %” (PP, w, 8 Jahre, pentekostal).
Obwohl Kinder mit ganz unterschiedlichen Bildungsniveaus interviewt worden, zeigen sie ein ähnliches Grundverständnis der Pandemie. COVID-19 wird von interviewten Kindern in beiden Ländern als potenziell tödliche Infektionskrankheit wahrgenommen. JA aus Ghana (w, 12 Jahre, charismatisch) erzählt, dass sie sich Sorgen um das Schicksal von Kindern mache: „Now some children are not supposed to die because of the COVID-19. They have to live and see the world.“ Auch Tiana (w, 15 Jahre, evangelikal) äußert, dass sie besorgt um Alte und Kinder sei: „Yes because maybe the aged their immune system aren’t strong, they get infected by the virus and then the infants too.“ Der dreizehnjährige Finn (evangelisch) sagt: „Das war halt schlimm zu sehen wie viele Menschen sterben. New York ist schon gar nicht mehr hinterhergekommen. Die mussten schon Kühllaster bestellen, um überhaupt die Verstorbenen dort lagern konnten bis dann die Beerdigung stattfindet.“
Neben Krankheit und Tod kommen in den Interviews auch Nebenfolgen der Pandemie bzw. ihrer Eindämmungsmaßnahmen als Belastungen für die Bevölkerung zur Sprache. Obwohl in beiden Ländern mehrere armutsbetroffene Kinder interviewt wurden, nehmen nur die in Ghana interviewten Kinder Bezug auf das Thema der Armut. Davida (w, 12 Jahre, evangelikal) stammt aus einer Familie mit niedrigem Einkommen aus dem ländlichen Raum. Sie malt sich aus, wie sie retrospektiv einmal ihren Kindern von der Pandemie erzählen werde: „I will tell my children that some disease came and it was like poverty came too.“ Die Sorge vor kollektiver Armut wird auch von Kindern geäußert, die selbst der sozialen Mittelschicht in Ghana angehören und somit nicht armutsbetroffen sind. Bless (m, 15 Jahre, protestantisch), dessen alleinerziehende Mutter Lehrerin ist, macht sich sehr viele Gedanken darüber, wie ärmere Bevölkerungsgruppen unter dem Lockdown leiden, obwohl ihn dies wahrscheinlich selbst nicht betrifft. Er erklärt, dass ärmere Menschen gar nicht zu Hause bleiben können, da sie täglich der Erwerbsarbeit bzw. Subsistenzwirtschaft nachgehen müssen, um zu überleben: „Because not everyone has a comfortable home. Most people go on farming, fishing and all those things which they don’t even have time for their books.“ Er hebt hervor, dass gerade für arme Bevölkerungsschichten ein ähnlich tödliches Risiko von dem Virus wie dem Lockdown selbst ausgeht: „You might not know whether you are going to recover or die of it. So, I think the only remedy is for you to stay at home, but you can die of hunger as well.“ In diesen Narrativen spiegelt sich die in Ghana verbreitete Vermittlung kollektivistischer Werte in der Sozialisation von Kindern (vgl. Hosny et al. 2020, S. 3524) als Orientierung gegenüber einem „larger set of individuals and their needs“ (ebd. S. 3530) wider. Diese Deutungen zeigen allerdings auch Kinder in Deutschland, die Sorge und Mitgefühl um das Wohlergehen von Menschen in anderen, stärker betroffenen Regionen äußern (vgl. Finns Zitat oben).
Es fällt in den Interviews mit den Kindern aus Ghana zudem auf, dass sie über einen kollektiv geteilten lebensweltlichen Wissensvorrat verfügen, die Qualität von medizinischen Produkten kritisch zu prüfen. Dies wird von den befragten Kindern in Deutschland nicht thematisiert, möglicherweise, weil sie es trotz zunächst nicht vorhandenem Impfstoff und zeitweiser Maskenknappheit grundsätzlich für selbstverständlich erachten, dass qualitativ einwandfreie medizinische Produkte vorhanden sind. PP (w, 8 Jahre, pentekostal) aus Ghana verweist hingegen darauf, dass Desinfektionsmittel einer bestimmten Qualität verwendet werden müssen (siehe oben), die teurer sind. Auch Tiana (w, 15 Jahre, evangelikal) erklärt, dass gefälschte Desinfektionsmittel im Umlauf seien, die ärmere Menschen kaufen müssten, da sie sich hochwertige Desinfektionsmittel aus der Drogerie nicht leisten können. Sie fügt hinzu, dass man stattdessen auch gut Händewaschen könnte, was in Ghana aber nicht immer möglich sei: „Maybe when travelling and you don’t have water and soap you just have to sanitize your hands.“
Deutungsmuster zu den Folgen der Pandemie und Eindämmungsmaßnahmen zeigen, dass Kinder in beiden Ländern eine Krisenlage deuten, die ihre eigene Lebenswelt und Betroffenheit überschreitet. Diese Relationierung zu anderen Menschen (Armutsbetroffene, Ältere, Menschen an Orten mit hoher Infektionsrate, etc.) ist hierbei wichtiger Bestandteil der Krisenwahrnehmung als Sorge um Andere, die sich mit ihren Bewältigungsstrategien als Sorge für Andere in Zusammenhang setzen lässt (vgl. Rohde-Abuba 2022).
In beiden Ländern gibt es Kinder, die sich auch mit der Verantwortung ihrer Regierung für das Pandemiemanagement auseinandersetzen. Zwei Kinder aus Ghana rekurrieren auf das gesellschaftskritische Potenzial von Religion, indem sie Gott als Instanz über die weltlichen Herrscher:innen stellen. So hinterfragen Bless (m, 15 Jahre, protestantisch) und JA (w, 12 Jahre, charismatisch), ob die Regierung im Sinne Gottes handele. Beide verweisen auf die Armut in Ghana und bemängeln, dass sich ihre Regierung nicht für den Ausgleich sozialer Ungleichheit bei der Umsetzung der Eindämmungsmaßnahmen einsetzt. Bless regt an, dass sich auch die Führungsverantwortlichen in ihrem Handeln an Gott orientieren, sich an die Maßnahmen halten und nicht alles negieren sollten:
“I think they [the leaders] should do enquiry of the Lord too […] And also, not do anything out of authority and also not taking everything not serious and also avoid every global and social gatherings as well” (Bless, m, 15 Jahre, protestantisch).
JA kritisiert, dass einige Mitglieder aus der politischen Führung in Ghana korrupt seien und schlussfolgert, dass Gott die Pandemie geschickt habe, um eine Wende einzuleiten:
“The leaders we choose some of them don’t have good intentions for the country. All they need is the country’s money, gold and things. […] So because of that God brought it so that after is gone we can have good intention. […] These days we will always choose a good leader” (JA, w, 12 Jahre, charismatisch).
Interessanterweise stellt JA die ghanaische Bevölkerung in die Verantwortung, ihre Regierung gewählt zu haben und imaginiert, dass nach einer Läuterung durch die Pandemie eine bessere Regierung gewählt werde. An anderer Stelle in ihrem Interview führt sie erneut aus, dass die Regierung nur an ihr eigenes Wohl denke und die Steuern und das Vertrauen der Bevölkerung missbrauche: „all our money and our trust has been in their hands“.
Diese Interviewpassagen können als Hinweis auf religiöses Coping in Form der von Dörr, Klein und Albani erweiterten Erklärungsansätze Murkens zur Bedeutung von Religiosität für die psychische Gesundheit gedeutet werden, der „Theorie der alternativen Werte“ (Klein und Albani 2011, S. 230–231). Hier entsteht ein entlastendes Potenzial durch Religiosität, indem „alternative Wertvorstellungen […] vermittelt und von den Anhängern ein[ge]fordert“ werden (Klein und Albani 2011, S. 230). Durch das Vertrauen auf eine „höhere Wirklichkeit“, die über der „diesseitigen Wirklichkeit“ steht, können Statuszuschreibungen innerlich relativiert werden (Konz 2022, S. 63). Indem Gott als eine Kraft verstanden wird, die das Geschehen auf der Welt transzendiert, kann zumindest gedanklich „eine Befreiung und Unabhängigkeit von endlichen Instanzen“ (Gennerich 2010, S. 132) imaginiert werden.
Auch in einigen Interviews aus Deutschland kommt Kritik an dem Handeln der Regierung in der Pandemie auf, allerdings wird diese nicht religiös gerahmt. Ähnlichkeiten zeigen sich aber in der Semantik: JA spricht im oberen Zitat von „trust has been in their hands“ und Midas spricht im folgenden Zitat von der „unzuverlässigen Regierung“. Weiterhin offenbaren sich Ähnlichkeiten in der sinnlogischen Argumentation, die Regierung handele nicht im Interesse der gesamten Bevölkerung. So kritisieren die Zwillinge Ally und Midas (w/m, 12 Jahre, katholisch), dass das Pandemiemanagement der Regierung Kinder benachteilige. Sie bemängeln, dass Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie Kinder in Deutschland besonders stark betroffen haben und Freizeitbereiche Erwachsener priorisiert wurden:
Interviewerin: „Was wisst ihr noch über ihn [COVID Virus]? Was hat man über ihn gehört?“
Ally: „Durch ihn konnten wir nicht mehr in die Schule.“
Midas: „Durch den müssen wir jetzt überall Masken tragen. Abstand halten. War zu Hause eingesperrt von der unzuverlässigen Regierung.“
Interviewerin: „Wieso unzuverlässig?“
Ally: „Weil die als erstes immer- dürfen Fußballfans in die Stadions usw. Und was ist mit den Kindern, die jetzt in die Schule kommen? Und das ist halt die Frage, warum tun die das? Warum kommt nicht zuerst die Schule?“
Midas: „Warum kommen Nagelstudios?“
Ally: „Ja, das ist auch die Frage. Das Ding ist, ist es denen wichtiger, dass die Erwachsenen glücklich sind oder eine gebildete Zukunft? Das ist dann halt auch so, wo man sich nur so denkt, ‚Leute, was ist wichtiger?‘“
(Ally und Midas, w/m, 12 Jahre, evangelisch)
Wie bei Ally und Midas werden auch in anderen Interviews aus Deutschland Konflikte entlang generationaler Linien beschrieben, die in den Interviews aus Ghana nicht zu finden waren. So berichtet Natascha (w, 13 Jahre, muslimisch) darüber, dass sie auf der Straße von älteren Menschen angepöbelt wurde, weil sie ihren Mundschutz nicht trug: „Und dann waren da so drei Ältere – also ein älterer Herr und zwei ältere Damen. Und dann haben die gesagt ‚Boah, heutzutage ist die Jugend echt eine Schande – gefährlich für die Älteren‘“. Lilly (w, 7 Jahre, atheistisch) erzählt, wie ihre Freundinnen sie besuchen wollten, und „dann hat Oma die angeschrien und gesagt ‚Geht weg‘. Die will mich ja auch nur schützen. Aber die braucht ja nicht gleich anschreien, oder?“
Obwohl die Interviewten überraschend fundierte Kenntnisse über das Virus und Hygienemaßnahmen vorweisen können und sich sehr ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen, scheinen Kinder in Deutschland selbst in Frage zu stellen, ob sie in Hinblick auf die Eindämmungsmaßnahmen verantwortlich (genug) handeln. Dies kann im Zusammenhang mit der besonderen Fokussierung des deutschen Diskurses auf eine mögliche Übertragung des COVID-19-Virus durch Kinder stehen, der in den Deutungsvorrat der interviewten Kinder eingegangen ist. Beispielhaft lässt sich dieses Narrativ in Peters (m, 16 Jahre, griechisch-orthodox) Interview feststellen. Seine Familie war besonders vorsichtig, weil er und seine Mutter sogenannte „Risikopersonen“ sind. Ausführlich berichtet er darüber, wie er das Vertrauen seiner Mutter gewinnen musste, dass er auch wirklich die Schutzmaßnahmen einhält:
„Dass sie [die Mutter] merkt, dass ich auch wirklich darauf achte, dass nichts passiert. Also, anfangs muss ja jeder erst mal sehen was ist. Ob man wirklich noch die Masken- muss man ja selber gucken, ob der Sohn die Masken trägt und ob der auch wirklich, wenn der nach Hause kommt, auch die Hände wäscht. Oder nicht direkt reingeht und alles direkt anfasst. Und dann vielleicht sogar den Virus hier in der Wohnung verbreitet“ (Peter, m, 16 Jahre, griechisch-orthodox).
Markant ist, dass Peter in seinem Interview viel darüber spricht, dass er sich Sorgen mache, seine Mutter anzustecken, und sich stark einschränkt, um dies zu verhindern. Umgekehrt thematisiert er jedoch nicht, dass er sich von seiner Mutter anstecken könnte, die teilweise in Präsenz arbeitete und das Haus für Einkäufe verließ.
Vergleichbare Narrative, die Kindern eine schlechtere Regelbefolgung als Erwachsenen zuschreiben, kommen in den Interviews aus Ghana nicht vor. Wenn eine mangelnde Regelbefolgung thematisiert wird, stellen die befragten Kinder sie in den Zusammenhang mit mangelnder Bildung und fehlenden Ressourcen, beides sozioökonomische Faktoren, die sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen. Charakteristisch dafür ist die Verwendung des alterslosen Begriffs „people“ in dem folgenden Zitat von JA (w, 12 Jahre, charismatisch). Sie deutet die Nicht-Befolgung von Hygieneregeln als Resultat mangelnder Hygienekenntnisse.
JA: „It’s [Maßnahmen, Hygieneregeln] helping the people who doesn’t normally wash their hands after visiting the bathroom or cleaning or cooking. Those who don’t normally know how to use the sanitizers, nose masks or they have not been well educated it has helped them too. […] You see people all of them with no nose mask. […]“
Interviewerin: „So, what do you think should happen to those people?“
JA: „They should help them because they don’t have.“
Interviewerin: „They don’t have. That is why they are behaving like that?“
JA: „Yes.“
Interviewerin: „Ok.“
JA: „Because if they have they will by all means wear it.“
(JA, w, 12 Jahre, charismatisch)
Dass Kinder in Ghana soziale Ungleichheit in der Pandemie entlang sozioökonomischer Linien und Kinder in Deutschland eher entlang generationaler Linien konstituieren, kann durch unterschiedliche Kindheitskonstruktionen in beiden Ländern kontextualisiert werden. Während in westlichen Kindheitskonstruktionen (vgl. Bühler-Niederberger 2011) die Identität des Kindes performativ und diskursiv besonders durch Spielen und Lernen hergestellt wird, beinhalten Kindheitskonstruktionen in Ghana auch eine Einbeziehung in Care-Arbeit und Erwerbsarbeit (Hosny et al. 2020, S. 3526). Dies bedeutet nicht, dass sich Tätigkeiten von Kindern empirisch zwischen den beiden Ländern unbedingt unterscheiden müssen, sondern dass sie in unterschiedlicher Weise für die Performativität von Kindheit bedeutsam sind. So geschieht Care-Arbeit durch Kinder in Deutschland beispielsweise eher versteckt und wurde in der Pandemie in Deutschland z. B. als „mit Geschwistern spielen“ gerahmt, auch wenn diese täglich mehrere Stunden Kinderbetreuung leisteten (Rohde-Abuba 2022). In westlichen Konstruktionen werden Entwicklungen und zunehmende Rechte und Pflichten stark an Alterskategorien gebunden. Reife und Entwicklung werden in westafrikanischen Ländern hingegen weniger vom Alter abhängig gemacht als von der individuellen Übernahme von Verantwortung für die Familie. An dieser können auch Erwachsene scheitern und als nicht zur Familie beitragendes Individuum sanktioniert werden. Die Verantwortungsfähigkeit von Kindern spiegelt sich im Maß ihrer Mitbestimmung innerhalb der Familie wider, durch die sie angesehen werden als „people who have earned the right to be consulted“ (Twum-Danso Imoh und Okyere 2020, S. 5). Trotz dieser Varianz in den Deutungen im Hinblick auf sozioökonomische oder altersspezifische Gründe für die Nichtbefolgung der Kontakt- und Hygieneregeln, konstruieren interviewte Kinder die Eindämmungsmaßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe, in der Kinder einen Beitrag zum Schutz ihrer Mitmenschen leisten und genau wie Erwachsene über die „Ability“ verfügen, sich in die Krisenbewältigung proaktiv einzubringen.
5 Religiöse Praktiken in der Pandemie
In Ghana sind Religion und persönlicher Glaube fest im Alltag verankert, so dass Glaubensbekenntnisse oder religiöse Praktiken in vielen gesellschaftlichen Institutionen vorkommen, wie z. B. in Form eines gemeinsamen Gebets in der Schule oder zu Beginn eines Arbeitstreffens, in familiären Alltagsroutinen wie Ess- und Schlafrituale oder in Situationen von Stress und Krankheit (Hosny et al. 2020, S. 3522 mit Bezug auf Okyerefo und Fiaveh 2017; Hosny et al. 2020, S. 3528). Gebete für ein Ende der Pandemie gehören zu diesen gemeinschaftlichen und individuellen Gebetspraktiken. Das spiegelt sich in den Interviews der Kinder wider. So äußert beispielsweise QZN (m, 10 Jahre, muslimisch): „Every time I prayed to God to take this pandemic.“ Auch IS (w, 11 Jahre, muslimisch) führt aus, für ein Ende der Pandemie gebetet zu haben, „because I want it to go so that we go back to school.“ Bless erzählt ähnlich (m, 15 Jahre, protestantisch): „I need to pray because we were close to the examination period and it can also disturb in my education and also can cause me much.“ Auch Kinder aus Deutschland berichten über Gebete in der Pandemie: Vanessa (w, 12 Jahre, katholisch) sagt, sie habe zwar nicht für das Ende des Homeschoolings gebetet, aber dafür, „dass meine Familie oder Freunde den Coronavirus nicht bekommen.“ Selbstverständlich und als positiver Copingfaktor wird das Gebet auch in zwei Interviews mit muslimischen Kindern aus Deutschland beschrieben. Kerem (m, 14 Jahre, muslimisch) sagt, er habe „oft gebetet, dass es weggehen soll, dass alle Menschen gesundwerden sollen“. Natascha (w, 13 Jahre, muslimisch) beschreibt im Interview, dass sie unter der Isolation im Lockdown leidet: „corona is killing me“. Beten ist für sie dagegen, gerade auch in der Pandemie, ein Beruhigungsfaktor: „Aber beten 5 × am Tag ist für mich so das Beste. Gibt mir sehr viel Kraft. Und es beruhigt mich von innen. Die Aggressionen, die ich in mir habe, sind dann weg.“ Mehmet (m, 16 Jahre, muslimisch) erzählt als einziges Kind in Deutschland von einem gemeinschaftlichen Gebet. Er sagt, dass es in seiner Heimatstadt (einer deutschen Großstadt) eine „Aktion von allen Religionen“ gab, bei der „der Hodscha dieses Gespräch sagt und alle so alle zum Beten ruft, das ist bei euch auch – das Klingeln von der Kirche.“ Diese Veranstaltung habe das Ziel gehabt, „dass alle Religionen auch zusammen sind gegen den Corona-Virus. Und dass wir Menschen zusammenhalten müssen.“
Für glaubende Kinder können Gebete als „Kontingenzbewältigungspraxis“ fungieren (Lübbe 2004, S. 161), weil sie „Artikulationshilfen und Resonanzräume“ bereitstellen, in die man sich auch mit sprachlich (noch) nicht artikulierbaren Gefühlen eintragen kann (vgl. Peng-Keller 2016, S. 37, 42; Kammeyer 2009, S. 126; Konz 2022, S. 72). Das Gebet bietet Artikulationsräume für Vulnerabilitätserfahrungen und hilft, Agency auch in ausweglosen Situationen zu generieren (vgl. Konz 2022, S. 72). Das Gefühl, dass Gott existiert, ansprechbar ist und „persönlich in das Leben eingreift“ (Flöter 2006, S. 236; vgl. Ulfat 2017, S. 49) kann gerade in Situationen, in denen kaum Handlungsspielraum besteht, entlastend sein (vgl. Konz 2022, S. 63). So kann Gott in Krisensituationen als Bündnispartner erlebt werden, der das „Gefühl eines unbedingten Angenommenseins“ (Klein und Albani 2011, S. 228) vermittelt und ansprechbar ist, wenn Bezugspersonen oder weltliche Instanzen hilflos sind (vgl. Konz 2022, S. 63). Mit dem Konzept der „VulnerAbility“ (Konz 2022, S. 56 ff.) können diese Praktiken als eigenständige Anwendung von erworbenen religiösen Deutungen und Praktiken verstanden werden, die individuelle Handlungsfähigkeit generieren vor dem Hintergrund widriger anderweitig nicht zu beeinflussender Umstände.
Interessant ist hierbei in welchem Verhältnis weltliche Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie und Gebete bei Kindern stehen, die beides praktizieren. Tiana (w, 15 Jahre, evangelikal), die sich in ihrem übrigen Interview sehr viel um die Nöte ärmerer Menschen als gesellschaftlicher Gruppe sorgt, fühlt sich durch ihren Glauben vor dem Virus geschützt. Sie zieht für sich das – in evangelikalen Kontexten zu findende – Deutungsmuster heran, dass Gott diejenigen sicher beschützt, die sich zu ihm bekennen und regelmäßig beten. Indirekt klingt in ihrem Zitat an, dass sie möglicherweise die Ansteckung mit dem Virus trotz weltlicher Schutzmaßnahmen auf mangelnden Glauben zurückführt:
“He always protect us and since this Corona virus came I don’t have any challenge with that. Maybe those who don’t believe in God they have that challenge because I always pray to God. He protects me and my family too. So we don’t have anything like the virus within us” (Tiana, w, 15 Jahre, evangelikal).
Im Interview mit FAG (w, 14 Jahre, muslimisch) zeigt sich besonders deutlich, dass das Vertrauen auf Gottes Beistand nicht im Widerspruch zu eigenverantwortlichen Handeln und der Einhaltung der Hygieneregeln stehen muss. Sie beschreibt, dass sie sich durch ihren Glauben geschützt fühlt, gleichzeitig aber auch auf sich selbst aufpassen muss:
Interviewerin: „In terms of the virus how do you feel about the virus now?“
FAG: „I am not scared of the virus anymore.“
Interviewerin: „You are not scared? Ok why are you not scared?“
FAG: „Because I know am always protected.“
Interviewerin: „Ok always protected by?“
FAG: „Allah.“
Interviewerin: „Ok but you still have the nose mask and all of that.“
FAG: „Yes.“
Interviewerin: „So why then do you use that if Allah is protecting you?“
FAG: „Even though Allah is protecting me I also have to protect myself.“
(FAG, w, 14 Jahre, muslimisch)
Im Sample gibt es auch glaubende Kinder, die in ihrer Gebetspraxis keine Bezüge auf die Pandemie nehmen. Dies betrifft hierbei nur Kinder, die in Deutschland leben. So sagt Anna (w, 15 Jahre, freikirchlich), dass sich in Bezug auf ihre Glaubenspraxis in der Pandemie „gar nichts geändert“ habe. Die Zwillinge Finn und Maya (m/w, 13 Jahre, evangelisch), die dem Glauben in ihrem Interview eigentlich hohe Bedeutung beimessen, geben im Interview an, zwar mitgefühlt, dies aber nicht regelmäßig in ihre Gebetspraxis eingebunden zu haben:
Finn: „[…] Ich habe wohl einmal gebetet, dass es nicht so schlimm wird und dass es gebremst wird und dass sich alle an die Regeln halten.“
Interviewerin: „Und du?“
Maya: „Gebetet habe ich nicht dafür. Aber generell abends beten wir ja immer.“
(Finn und Maya, m/w, 13 Jahre, evangelisch)
Peter (m, 16 Jahre, griechisch-orthodox) differenziert im Interview zwischen einer naturwissenschaftlich-medizinischen Weltsicht, die im Fall der Pandemie zum Tragen kommt, und seiner Religiosität, die für ihn ein Faktor der Gemeinschaft und Zugehörigkeit ist. Er ist politisch sehr interessiert und medizinisch versiert, da seine Mutter Krankenschwester war. Die Pandemie kann seiner Ansicht nach nur durch medizinische Maßnahmen bekämpft werden, so dass er keine religiösen Handlungsmöglichkeiten- oder Erfordernisse sieht. Im Interview betont er: „Ich habe nicht wirklich gebetet darüber, dass es weggeht. So wirklich in der Kirche war ich während Corona auch nicht. Also gar nicht. Deswegen glaube ich – Corona und Religion war Null verbindlich.“ Da diese Kinder sich nicht äußern, warum die Pandemie für sie kein Gebetsanlass darstellt, können diese Datenstücke nicht weiter interpretiert werden. Es lässt sich hiermit feststellen, dass die Gebetspraxis somit ein wichtiger Bestandteil der „VulnerAbility“ glaubender Kinder in der Pandemie sein kann, gleichzeitig aber nicht bedingt, dass glaubende Kinder auf Gebetspraktiken angewiesen sind, um die Pandemie bewältigen zu können. Für den deutschen Kontext zeigt auch der ‚Religionsmonitor‘ der Bertelsmannstiftung (2023, S. 9), dass Religion eine wichtige „Stütze“ in der Pandemie sein kann, aber auch für glaubende Menschen nicht die alleinige oder wichtigste Resilienzressource darstellen muss.
Mutmaßlich können Unterschiede in der Bedeutung religiöser Deutungen und Praktiken für die Bewältigung der Pandemie, die sich in den Interviews mit Kindern aus Ghana und Deutschland abzeichnen, auch darauf zurückgeführt werden, welche lebensweltlichen Angebote zur Verfügung stehen. Während in Ghana vielerorts religiöse Versammlungen weiterhin durchgeführt wurden, berichten Kinder aus Deutschland von einer Schließung ihrer Gemeinden. Zwar sind nicht alle der glaubenden Kinder aus dem deutschen Sample in eine Gemeinde aktiv eingebunden, aber Vanessa, Peter, Maya und Finn oder Natascha, die regelmäßig eine Gemeinde besuchen, deuten die auf unbestimmte Zeit ausgesetzten gemeindlichen Aktivitäten als Beziehungsabbruch. Vanessa (w, 12 Jahre, katholisch) führt aus, dass der Gottesdienst für sie eine heilsame Wirkung habe, die sie zu Zeiten der Pandemie nicht erleben kann: „Weil, wenn man in schwierigen – so zum Beispiel bei Corona, dass man auch beten kann, dann fühlt man sich auch besser. Und auch jetzt, wenn nicht groß Corona war, in die Kirche geht, wenn man singt und betet, dann fühlt man sich auch besser.“
Finn und Maya (m/w, 13 Jahre, evangelisch) befanden sich zur Zeit des Interviews eigentlich in der Vorbereitung auf ihre Konfirmation, aber der Konfirmand:innenunterricht war wegen der Pandemie ausgesetzt und wurde nicht online durchgeführt.
Maya: „Gut, in der Corona-Zeit hatten wir nicht so oft Unterricht. Nicht so normal.“
Finn: „Nur ein Mal.“
Maya: „Aber schon ganz OK. Viele kenne ich da noch gar nicht – ist eine ziemlich große Gruppe. Aber macht schon Spaß.“
(Finn und Maya, m/w, 13 Jahre, evangelisch)
Dass religiöse Übergänge ausgesetzt oder aufgeschoben wurden, beschrieben auch interviewte Kinder aus Ghana. Im Gesamten berichten sie jedoch weniger als die Befragten in Deutschland davon, dass die Pandemie ihre religiösen Gemeinschaftspraktiken beeinträchtigt habe. Zwar wurden vielerorts Gottesdienste in Innenräumen unterbunden, aber einige Gemeinden führten diese dann draußen durch, wie beispielsweise Francis (m, 13 Jahre, katholisch) geschildert hat: „Even we don’t go to Church as we do formally. We space out.“
Schulschließungen in der Pandemie wurden nicht nur als negativ erlebt, gerade in Hinsicht auf religiöse Feiern von Minderheitenreligionen in Deutschland ergaben sich hierdurch Freiheiten, die einige interviewte Kinder als positiv bewerten. Insofern sich die Schule in Deutschland am christlichen Festkalender orientiert, ermöglichte der Lockdown muslimischen Kindern, den Ramadan in diesem Jahr besser oder leichter einzuhalten, da der Präsenzunterricht ausgesetzt war und sie ihren Tagesrhythmus frei wählen konnten. Susan (w, 14 Jahre, muslimisch) sagt, sie habe „dieses Jahr fast komplett durchgefastet, aber das war dieses Jahr leichter, weil man zu Hause war und es war Corona.“ Auch Mehmet (m, 16 Jahre, muslimisch) beschreibt es ähnlich:
„Die Fastenzeit war ja auch in der Corona-Zeit. Da bin ich sehr spät ins Bett gegangen. Wir dürfen ja erst so ab 3 Uhr nachts was essen. Dann habe ich bis dahin auch mit Freunden gezockt oder Filme geguckt. Und dann bin ich so um 12–13 Uhr aufgestanden. […] Dann habe ich immer so ein Mittagsschlaf gemacht. Mit den Eltern auch im Wohnzimmer unten was zusammen gemacht. Fernsehen geguckt. Brettspiele gespielt oder im Garten was gemacht“ (Mehmet, m, 16 Jahre, muslimisch).
Die interviewten muslimischen Kinder in Ghana schildern keine besonderen Auswirkungen des Lockdowns auf den Tagesablauf im Ramadan. Allerdings berichten dort einige muslimische und christliche Kinder, dass sie durch die Schulschließungen mehr Zeit gehabt hätten, sich mit ihrem Glauben zu beschäftigen.
“Because when this Coronavirus came my best friend, the one I told you about called me and reading the Bible and also reading all the statutes. I just started about two weeks ago. I started reading the whole Bible and I found it interesting. So I have just got closer to God and that is why I had a little space in it” (Bless, m, 15 Jahre, protestantisch).
Im Sinne der VulnerAbility legen Kinder dar, wie sich für sie durch die medizinisch und gesellschaftliche Krise der Pandemie auch persönliche Handlungsmöglichkeiten geöffnet haben, die sie positiv nutzen konnten. Interessanterweise (und es ist nicht auszuschließen, dass dies durch das Sampling und Setting mit dem Fokus auf Religion bedingt ist), berichten die betreffenden Kinder hierbei nicht über eine intensivere Beschäftigung mit ihren Hobbys, die ihnen die Schulschließungen ermöglichten, sondern über eine Intensivierung der Religionspraxis. Sie deuten die Pandemie somit auch als Phase des religiösen Wissens- und Erfahrungsaufbaus.
6 Religiöse Deutungen der Pandemie und Umgang mit Verschwörungstheorien
Die Deutungsmuster ihrer Umgebungen geben Kindern rahmende kognitive, evaluative und normative Elemente, die ihre Wahrnehmung und Interpretation der Pandemie prägen (vgl. dazu Ullrich 1999, S. 2) und von denen ausgehend auch Versuche zur Deutung der Pandemie angestellt werden. In Interviews aus Ghana beinhalten diese Deutungsmuster regelmäßig religiöse Bezüge. So deuten Kinder die Pandemie als strafende Erziehungsmaßnahme Gottes oder sie sehen in ihr eine Prüfung Gottes, ob die Menschen fähig seien, ihr Handeln zu ändern. Beispielhaft dafür ist das Interview mit Tiana (w, 15 Jahre, evangelikal):
“Because our sins are many. In the Bible they said because of our sins God was annoyed and He threw maybe an outbreak of disease which is maybe this Corona virus. So, for us to change our way of living so maybe when this virus end and we don’t change He will bring different outbreak of disease to the world again” (Tiana, w, 15 Jahre, evangelikal).
IAD (w, 12 Jahre, katholisch) glaubt daran, dass Gott das Virus geschickt habe, um die Menschen zu prüfen: „Maybe it might be true that God has sent it to see those who are righteous to him.“ In den Interviews in Deutschland wird das Deutungsmuster des prüfenden Gottes von Susan (w, 14 Jahre, muslimisch) vorgebracht: „Vielleicht ist es auch nur eine Prüfung, wie die Menschheit damit klarkommt. Wie sie das regeln wird. So könnte ich es mir vorstellen. Weil, das Leben soll ja nur eine Prüfung sein.“ Sie bezieht sich dabei auf eine Glaubensansicht im Islam, dass Allah die Menschen prüft und dass man, wenn man sein Schicksal meistert, von Gott im Himmel belohnt werde. JA (w, 12 Jahre, charismatisch) erklärt, dass Menschen Gott testen wollten und ihn provoziert haben, woraufhin dieser die Menschen erziehen muss. Sie sieht die Pandemie damit auch als Beweis für Gottes Existenz und Macht.
“Normally some people test God because they think God can’t do it so they try to provoke Him to do what He doesn’t want to do. That is why He brought this to the country. […] Because it’s no one’s fault. Some people just provoke Him. They will sit down and just say something to provoke Him. Because he doesn’t want to do it. […] So they want to see Him doing it before they will be free. That is what some people do” (JA, w, 12 Jahre, charismatisch).
AJW (w, 13 Jahre, protestantisch) leitet aus der religiösen Deutung der Pandemie konkrete Anforderungen ab, dass eine Veränderung auf individueller oder kollektiver Ebene notwendig sei. Sie deutet die Pandemie als Zeichen der Endzeit und fühlt sich herausgefordert, den Glauben zu intensivieren und andere zu missionieren. „I think the end time is near. […] I can now be a God fearing person […] So, I will now worship God and tell people about God.“ AN (m, 13 Jahre, traditionell) hingegen betont die Notwendigkeit einer bewussteren Lebensführung in Verbindung zu Gott. Die Pandemie sei geschehen, „to take care of ourselves. Like maybe you want to pray.“
Bezüglich der Frage, wofür Gott Menschen bestrafe oder welche Verhaltensweisen durch die Pandemie korrigiert werden sollen, nennen die Kinder in Ghana eine große Bandbreite von Aspekten, die ihnen in ihrer lebensweltlichen Sozialisation als negatives Verhalten vermittelt wurden. Beispielsweise erklärt BBD (m, 12 Jahre, muslimisch) auf Nachfrage, was die Gründe einer Strafe Allahs sein könnten: „bad behaviours of people“ und ergänzt „like prostitution“ und „stealing“. In einem anderen Interview findet sich eine freikirchliche Ablehnung von Homosexualität, die JA (w, 12 Jahre, charismatisch) möglicherweise aus einer Deutung von Homosexualität als Ursache für HIV ableitet und auf die Pandemie übertragt: „Right now COVID-19 is a punishment from God. Some other countries believes in gay. They do gay stuffs and all these things. They don’t believe in God.“ Davida (w, 12 Jahre, evangelikal) aus Ghana erklärt den Ursprung des Virus zunächst mit Ernährungsweisen in China, auf Nachfrage setzt sie ihn dann in Zusammenhang mit apokalyptischen Texten der Bibel:
Davida: „I heard that the Chinese people eat frogs, eat snacks and other things like bats. That is why.“
Interviewerin: „That is why Corona came?“
Davida: „Yes.“
Interviewerin: „Ok but people are also saying that Corona is from God? What do you think?“
Davida: „Yes.“
Interviewerin: „Really? Why?“
Davida: „But is in the Bible.“
Interviewerin: „Is in the bible? Ok that?“
Davida: „That there will be serious earthquake and they will face a lot of troubles and poverty too will come.“
(Davida, w, 12 Jahre, evangelikal)
Auch Francis (m, 13 Jahre, katholisch) geht davon aus, dass der Ursprung des Virus in China liegt: „They have been eating Snake, Lizard and other stuffs. That is why.“ Der Virus sei dann als Strafe von Gott nach Ghana gekommen, um die Menschen für traditionelle Glaubenspraktiken zu bestrafen: „Some people will be doing, they will go to the shrine and the gods will tell them that go and bring this, go and bring this and you will get money. Yes, that is why. […] It is also a punishment.“ Auf die Frage, was nun getan werden könne, um den Virus zu bekämpfen, antwortet Francis: „We should stop doing bad things and we should pray that God will protect us and let the Corona go.“ In Francis Narration verbinden sich unterschiedliche Aspekte: er verknüpft die Vorstellung, dass der Ursprung des Virus in China durch den Verzehr von Wildtieren entstanden ist, mit einer religiös begründeten Ablehnung traditioneller Glaubenspraktiken in Ghana, bei denen oft auch Tierblut involviert ist. Er deutet die Pandemie als eine Strafe für Praktiken, die er in biologischer Hinsicht als unhygienisch und in religiöser Hinsicht als nicht gottgefällig identifiziert. Auch andere Kinder aus Ghana grenzen sich im Interview von den traditionellen religiösen Kulten ab, weil sie mutmaßen, dass diese eine Leugnung des Corona-Virus und eine Ablehnung der staatlichen Maßnahmen befördern. Zudem befürchten sie, dass bei Ritualen, Trankopfern und Opfergaben in den Schreinen (vgl. Ntewusu und Nkumbaan 2020) unhygienische Verhältnisse herrschen und diese zu einer Verbreitung des Virus beitragen. In IADs (w, 12 Jahre, katholisch) Argumentation erkennt man möglicherweise die Sensibilisierung durch die HIV-Aufklärung, wenn sie mutmaßt, dass das Blut der in den Schreinen geopferten Tiere eine Ansteckungsgefahr berge:
“Because like maybe they will have a specific bowl that they pour the blood or something in the bowl. So, when somebody touches the bowl and the person lives another person will touch it. If the person has the pandemic the person might also get the virus” (IAD, w, 12 Jahre, katholisch).
Deutungen, die die Schuld an der Pandemie einer bestimmten Religionsgruppe zuschreiben, lassen sich auch in den deutschen Interviews finden, allerdings ohne dabei eine konkrete biologische Deutung des Virusursprungs oder der Virusübertragung anzugeben. Die Geschwister Sarah (w, 16 Jahre, jüdisch) und Noam (m, 12 Jahre, jüdisch) aus Deutschland sind von den Verschwörungstheorien direkt betroffen, wenn hierbei das antisemitische Stereotyp eines nach Weltherrschaft strebenden Judentums befördert wird. Sie stellen dies in den historischen Zusammenhang, dass Jüd:innen schon im Mittelalter für Katastrophen verantwortlich gemacht wurden. So äußert Sarah, sie habe gehört: „Die Juden wurden für das beschuldigt. Die Juden haben auch an der Pest Schuld. Also haben die Juden auch an Corona Schuld. Juden haben das entwickelt, um dies zu machen“.
Andere Kinder in Deutschland beschäftigen sich in ähnlicher Semantik und Argumentation wie Kinder in Ghana mit dem mutmaßlichen Verzehr von Wildtieren in China im Hinblick auf die Ursache der Pandemie, allerdings ohne religiöse Bezüge einzufügen. Natascha (w, 13 Jahre, muslimisch) sagt, aus der Pandemie könne man lernen „dass die Chinesen keine Tiere mehr essen. […] Die essen da sehr viele Tiere. Zum Beispiel Fledermäuse. Und ich habe gehört, dass auch aus Fledermäusen Corona kommt.“ Ähnlich führt auch Peter (m, 16 Jahre, griechisch-orthodox) aus:
„Also, ich finde es ja sowieso schon falsch, alles zu essen was es gibt. Was ich so sehe in China auf dem ganzen Markt – sowas finde ich schon ganz schön übertrieben. […] Und wenn man aus sowas lernt und Sachen mitnimmt, wie zum Beispiel das man einfach hygienischer wird oder dass man vielleicht trotzdem mal Masken anbehalten sollte. Das man sowas sehr stark vermeiden kann“ Peter (m, 16 Jahre, griechisch-orthodox).
Neben dem Verzicht auf Wildtierverzehr, der Kinder in Deutschland kaum betrifft, nennen Kinder in Deutschland als Veränderungsbedarfe, die ihnen durch die Pandemie bewusst geworden sind, vor allem ein besseres Hygieneverhalten. Mehmet (m, 16 Jahre, muslimisch) sagt: „Ja. Man ist mehr Achtsam. Man achtet man was man anfasst. Man ist sauberer. Man wäscht sich öfter die Hände. […] Es gibt ja auch andere Krankheiten. Deswegen finde ich es besser. Lieber sauber als dreckig.“ Ähnlich erläutert auch Kerem (m, 14 Jahre, muslimisch), „dass wir Menschen auf die Hygiene aufpassen. Dass wir öfter unsere Hände waschen. Sauberer werden und so.“
Interessanterweise kommt die Deutung, dass sich die Menschen über das Hygieneverhalten hinausgehend verändern sollten, die in Ghana in Zusammenhang mit Gottes Wirken gestellt wird, in den Verweisen deutscher Kinder auf Verschwörungstheorien vor. Peter (m, 16 Jahre, griechisch-orthodox) distanziert sich explizit: „Gibt es ja auch. Verschwörungstheoretiker. Die sagen ja ganz viel woher sowas kommen kann. […] Aber es gab ja extrem viele Theorien. Genauso wie die Theorie mit Bill Gates – ich weiß nicht ob Sie die kennen? Mit den ganzen Infusionen und alles.“ Kerem (m, 14 Jahre, muslimisch) erzählt, dass er im Fernsehen gehört habe: „Dass es geplant ist, um die Menschheit zu verändern. Um die Menschen in Kontrolle zu haben.“ Er weist auf Verschwörungstheorien hin, nach denen eine Weltherrschaft angestrebt wird. Er selbst glaube jedoch nicht daran, sondern nehme an „das ist einfach ein Virus. Das ist normal.“
7 Schlussfolgerungen
Dieser Aufsatz untersucht die VulnerAbility (Konz 2022, S. 56 ff.) von Kindern in Ghana und Deutschland während der Pandemie bezüglich der Frage, wie Kinder im Rückgriff auf ihre Religiosität Handlungsfähigkeit im Sinne einer Agency herstellen und in der Sozialisation erworbenes religiöses Wissen und Praktiken sinnstiftend für konkrete Problemstellungen in ihren Lebenskontexten adaptieren. Es nimmt ihre Fähigkeit in den Blick, Lebenswelt mitzugestalten, auch wenn sie sich in vulnerabilisierenden Situationen und Strukturen befinden.
Methodisch verfolgte dieser Aufsatz das Ziel, weltliche und religiöse Deutungen von Kindern zu identifizieren und im Hinblick auf kollektiv geteilte semantisch und inhaltlich-argumentative Muster zu untersuchen. Arnold (1985, S. 23 im Rückgriff auf Schütz 1981) versteht Deutungsmuster als „Situations‑, Beziehungs- und Selbstdefinitionen“ zu Orientierung und Legitimation alltäglichen Handelns. Pandemiebezogenes Handeln war zunächst nicht alltäglich, sondern Kinder waren mit bisher unbekannten Herausforderungen und Ängsten konfrontiert, die ihre VulnerAbility erforderten. Verbindet man beide Konzepte – die der Deutungsmusteranalyse und der VulnerAbility – lässt sich folgendes feststellen: Deutungen der pandemischen Situation zeigen als geteilte Muster die Wahrnehmung einer ernsthaften, globalen Krankheit mit einem realistischen Todesrisiko. Dies bezogen Kinder nicht nur auf sich selbst und ihre unmittelbare Familie, sondern konnten auch über das Wohlergehen anderer, oft stärker benachteiligter Menschen als sie selbst reflektieren. Hier zeigt sich die Entwicklung von Empathie und Solidarität als Grundlage für gemeinschaftsbezogenen Schutzmaßnahmen (im Sinne einer „Ability“), zu denen Kontakt-und Hygieneregeln gehören, und für einige glaubende Kinder auch regelmäßige Schutzgebete. Diese medizinischen und religiösen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschreiben dabei zugleich eine Dimension der Beziehungsdeutung in der Pandemie: den Schutz der Mitmenschen. Gleichzeitig zeigen Narrative auf der Beziehungsebene eine Abgrenzung von Personen, die diese Schutznahmen nicht durchführen. Neben Deutungen, die Unwissen oder Ignoranz zuschreiben, können hier auch religiös konnotierte Deutungen mobilisiert werden, die Grenzziehungen zu stigmatisierten Lebens- oder Glaubensweisen herstellen. VulnerAbility entsteht dabei durch die Bestätigung, dass die eigenen Lebens- oder Glaubensweisen bestmöglich zu einer Überwindung der Krise beitragen oder zumindest nicht Schuld an dieser sind, was auch relevant für Deutungen auf der Ebene der Selbstdefinition in der Pandemie sind. Hier wird weiterhin wirksam, dass Kinder in der Durchführung medizinischer Eindämmungsmaßnahmen und auch im Gebet über Mittel verfügen, in denen sie im gleichen Maße wie Erwachsene aktiv zu einer Bekämpfung der Pandemie beitragen. Ferner ist auf der Ebene der Selbstdefinitionen relevant, dass die Pandemie neben ihren Belastungen als Phase der persönlichen Veränderung gesehen werden kann. Neben eher profanen Erkenntnissen bezüglich des Nutzens einer besseren Hygiene, kann die Pandemie auch als Phase des religiösen Wachstums erfahren werden. Vor dem Hintergrund der Konfrontation mit Leid und Tod beinhaltet dies zum einen die Adaption religiöser Deutungen für eigene Verstehensprozesse der Pandemie und zum anderen das Eintragen von Sorgen und Ängsten der Pandemie in religiöse Praktiken als Bewältigungsprozesse.
Bringt man diese drei Deutungsebenen zusammen, zeigt sich VulnerAbility in pandemiebezogenen Narrativen zunächst als Situationsverständnis, das unterschiedliche Handlungsoptionen beinhaltet, dann als Positionierung innerhalb von Beziehungsstrukturen, die anhand richtigen und falschen Verhalten identifiziert werden, und schließlich als Selbstdefinition, die die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens im Hinblick auf die Bewältigung der Situation und einem möglichen persönlichen Mehrwert interpretiert. Diese grundsätzlichen Strukturen lassen sich übergreifend in den Narrativen von Kindern in Ghana und Deutschland finden. Auch hinsichtlich der religiösen Bezüge gibt es große Schnittflächen. Trotzdem muss auch festgestellt werden, dass Religiosität im privaten und öffentlichen Lebensalltag in Ghana wesentlich präsenter ist und ghanaische Kinder damit über ein größeres religiöses Wissens- und Handlungsrepertoire verfügen, auf das sie einerseits für ihre VulnerAbility zurückgreifen können, und das andererseits Herausforderungen in Hinblick auf die eigene oder gemeinschaftliche religiöse Fehlbarkeit mit sich bringt. Die größten Limitationen dieser Studie liegen dabei offensichtlich in dem kleinen Sample und auch dem qualitativen Forschungsdesign, das es letztendlich nicht zulässt, zu verifizieren, ob vorgefundene Deutungsvarianten methodisch durch das Sampling bedingt sind und inhaltlich eher auf individuelle oder kontextspezifische Unterschiede hinweisen.
Notes
Seit 2007 führt das internationale Kinderhilfswerk World Vision Deutschland die „World Vision Kinderstudie“ durch. Die ersten vier Ausgaben haben mithilfe qualitativer und quantitativer Daten repräsentative Informationen über Kinder unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen in Deutschland hinsichtlich ihrer Lebenswelten und ihrem Wohlbefinden geliefert. Die 5. World Vision Kinderstudie wurde nun erstmals binational, in Deutschland und Ghana, erhoben.
In Ghana waren die Schulen bis Ende 2021 insgesamt 10 Wochen komplett und 29 Wochen teilweise geschlossen. In Deutschland waren sie im selben Zeitraum 14 Wochen komplett und 24 Wochen teilweise geschlossen. Beispielsweise in Frankreich waren sie hingegen nur 7 Wochen komplett und 5 Wochen teilweise geschlossen (vgl. Unesco 2022 abrufbar unter https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/).
Literatur
Andresen, Sabine, und Sascha Neumann. 2018. Die 4. World Vision Kinderstudie: Konzeptionelle Rahmung und thematischer Überblick. In Kinder in Deutschland 2018. 4. World Vision Kinderstudie, 35–53. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Andresen, Sabine, Klaus Hurrelmann, und Susann Fegter. 2010. Wie geht es unseren Kindern? Wohlbefinden und Lebensbedingungen der Kinder in Deutschland. In Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision Kinderstudie, Hrsg. World Vision Deutschland, 35–60. Frankfurt am Main: Fischer.
Anyan, Frederick, und Birthe Loa Knizel. 2018. The coping mechanisms and strategies of hypertension patients in Ghana: the role of religious faith, beliefs and practices. Journal of Religion and Health 57:1402–1412.
Arnold, Rolf. 1985. Deutungsmuster und pädagogisches Handeln in der Erwachsenenbildung. Aspekte einer Sozialpsychologie der Erwachsenenbildung und einer erwachsenenpädagogischen Handlungstheorie. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Bühler-Niederberger, Doris. 2011. Lebensphase Kindheit. Theoretische Ansätze, Akteure und Handlungsräume. Weinheim München: Juventa.
Corbin, Juliet, und Anselm Strauss. 2008. Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory, 3. Aufl., Los Angeles: SAGE.
Corsaro, William. 1996. Transitions in early childhood. The promise of comparative longitudinal Ethnography. In Ethnography and human development, Hrsg. Richard Jessor, Ann Colby, und Richard Shweder, 419–458. Chicago: University of Chicago Press.
Fegter, Susann, und Martina Richter. 2013. The capability approach as a framework for research on children’s well-being. In Handbook of child well-being, Hrsg. Asher Ben-Arieh, Jill Korbin, Ivar Frønes, und Ferran Casas, 739–758. Dordrecht: Springer VS.
Flöter, Ilse. 2006. Gott in Kinderköpfen und Kinderherzen. Welche Rolle spielt Gott im Alltagsleben zehnjähriger Kinder am Anfang des 21. Jahrhunderts? Eine qualitativ-empirische Untersuchung. Berlin: LIT.
Gärtner, Christel. 2013. Religiöse Identität und Wertbindungen von Jugendlichen in Deutschland. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 65:211–233.
Gärtner, Claudia. 2020. Klima, Corona und das Christentum. Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung in einer verwundeten Welt. Bielefeld: transcript.
Gennerich, C. 2010. Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionsdidaktische Reflexionen. Stuttgart: Kohlhammer.
Haußmann, Annette. 2019. Ambivalenz und Dynamik. Eine empirische Studie zu Religion in der häuslichen Pflege. Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs, Bd. 26. Berlin, Boston: De Gruyter.
Herma, Holger. 2009. Liebe und Authentizität. Generationswandel in Paarbeziehungen. Wiesbaden: VS.
Honig, Michael-Sebastian. 2017. Institutionalisierte Kindheit. Kindeswohl als kindheitstheoretisches Konstrukt. https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/30527/1/Honig_imprimatur_170110.pdf. Zugegriffen: 31. Dez. 2020.
Honig, Michael-Sebastian. 2009. Das Kind der Kindheitsforschung. Gegenstandskonstitution in den Childhood Studies. In Ordnungen der Kindheit. Problemstellungen und Perspektiven der Kindheitsforschung, Hrsg. Michael-Sebastian Honig, 25–51. Weinheim, München: Juventa.
Hosny, Nadine, Adam Danquah, Katherine Berry, und Ming Wai Wan. 2020. Children’s narratives of family life in Ghana: a cultural lens via story stems. Journal of Child and Family Studies 29:3521–3535.
James, Allison, und Alan Prout. 1990. A new paradigm for the sociology of childhood. Provenance, promise and problems. In Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood, Hrsg. Allisom James, Alan Prout, 7–33. London: The Falmer Press.
James, Allison, Chris Jenks, und Alan Prout. 1998. Theorizing childhood. Oxford: Polity Press.
Kammeyer, Katharina. 2009. „Lieber Gott, Amen!“. Theologische und empirische Studien zum Gebet im Horizont theologischer Gespräche mit Vorschulkindern. Stuttgart: Calwer.
Klein, Constantin, und Cornelia Albani. 2011. Religiosität und psychische Gesundheit – empirische Befunde und Erklärungsansätze. In Gesundheit – Religion – Spiritualität. Konzepte, Befunde und Erklärungsansätze, Hrsg. Constantin Klein, 215–246. Weinheim: Juventa.
Konz, Britta. 2022. „Gott macht mich mutig.“ Religiöse Selbst- und Weltdeutungen von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Fluchterfahrungen. In Flucht und Religion. Religiöse Verortungen und Deutungsprozesse von Kindern und Eltern mit Fluchterfahrungen, Hrsg. Britta Konz, Caterina Rohde-Abuba, 53–90. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Kraus, Björn. 2006. Lebenswelt und Lebensweltorientierung – eine begriffliche Revision als Angebot an eine systemischkonstruktivistische Sozialarbeitswissenschaft. Zeitschrift für Systemische Therapie und Familientherapie 37(02):116–129. http://www.webnetwork-nordwest.de/sowi/article.php?sid=92 [Zugriff: 16.02.2023].
Kuckartz, Udo. 2010. Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten, 3. Aufl., Wiesbaden: VS.
Kuckartz, Udo. 2012. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim: Beltz Juventa.
Kuckartz, Udo. 2018. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 4. Aufl., Weinheim Basel: Beltz Juventa.
Lübbe, Hermann. 2004. Religion nach der Aufklärung. München: Wilhelm Fink.
Magson, Natasha, Justin Freeman, Ronald Rapee, Cele Richardson, Ella Oar, und Jasmine Fardouly. 2021. Risk and protective factors for prospective changes in adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. Journal of Youth and Adolescence 50:44–57.
Matsumoto, David, und Linda Juang. 2004. Culture and psychology, 3. Aufl., Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning.
Maull, Ibtissame Yasmine. 2017. Gottesbilder und Gottesvorstellungen vom Kindes- zum Jugendalter. Eine qualitativ-empirische Längsschnittuntersuchung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Mayall, Berry. 2001. The sociology of childhood in relation to children’s rights. The International Journal of Children’s Rights 8:243–259.
Ntewusu Aniegye, Samuel, und Samuel Samuel Nkumbaan. 2020. Fighting COVID-19: Interventions from Ghana’s Traditional Priests. Religious Matters in an Entangled World Blog. https://religiousmatters.nl/fighting-COVID-19-interventions-from-ghanas-traditional-priests/. Zugegriffen: 19. Apr. 2022.
Okyerefo, Michael Perry Kwek, und Daniel Yaw Fiaveh. 2017. Prayer and healthseeking beliefs in Ghana: understanding the ‘religious space’ of the urban forest. Health Sociology Review 26(3):308–320.
Oppong, Seth. 2015. A critique of early childhood development research and practice in Africa. Africanus. Journal of Development Studies 45(1):23–41.
Peng-Keller, Simon. 2016. Gebet als sinnliches Sinnereignis. Annäherung an die Leiblichkeit des Verstehens im Gebet. In Beten als verleiblichtes Verstehen. Neue Zugänge zu einer Hermeneutik des Gebets, Hrsg. Ingolf Dalferth, Simon Peng-Keller, 25–49. Freiburg im Breisgau: Herder.
Religionsmonitor. 2023. Religion als Ressource der Krisenbewältigung? Analysen am Beispiel der Coronapandemie. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ReligionKrisenbew_2023_final2.pdf. Zugegriffen: 15. März 2023.
Ritter, Werner H., Helmut Hanisch, Erich Nestler, und Christoph Gramzow. 2006. Leid und Gott. Aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Roggenkamp, Antje, und Verena Hartung. 2020. Theologisieren mit eigenen Gottesbildern. Brüche und Spannungen in Gottesdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Berlin: LIT.
Rohde-Abuba, Caterina. 2022. Children as actors of family care during the COVID-19 pandemic. In COVID, Crisis, Care, and Change? International Gender Perspectives on Re/Production, State and Feminist Transitions, Hrsg. Antonia Kupfer, Constanze Stutz, 95–107. Barbara Budrich.
Sachweh, Patrick. 2009. Deutungsmuster sozialer Ungleichheit. Wahrnehmung und Legitimation gesellschaftlicher Privilegierung und Benachteiligung. Frankfurt New York: Campus.
Schütz, Alfred. 1981. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Simojoki, Henrik. 2017. Im Dazwischen. Zur Liminalität von Religion und Bildung in der postmigrantischen Gesellschaft. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 69:26–36.
Szagun, Anna-Katharina. 2014. Dem Sprachlosen Sprache verleihen [Kinder erleben Theologie; 1]. Jena: Garamond, Ed. Paideia.
Teo, Thomas. 2008. From speculation to epistemological violence in psychology: a critical hermeneutic reconstruction. Theory and Psychology 18(1):47–67.
Imoh Twum-Danso, Afua. 2016. For the singular to the plural: Exploring diversities in contemporary childhoods in sub-Saharan Africa. Childhood 23(3):455–468.
Twum-Danso Imoh, Afua, und Samuel Okyere. 2020. Towards a more holistic understanding of child participation: Foregrounding the experiences of children in Ghana and Nigeria. Children and Youth Services Review 112(2020):10492.
Ulfat, Fahimah. 2017. Die Selbstrelationierung muslimischer Kinder zu Gott. Eine empirische Studie über die Gottesbeziehungen muslimischer Kinder als reflexiver Beitrag zur Didaktik des Islamischen Religionsunterrichts. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Ullrich, Carsten. 1999. Deutungsmusteranalyse und diskursive Interview. Leitfadenkonstruktion, Interviewführung und Typenbildung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 3. http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-3.pdf. Zugegriffen: 16. Febr. 2023.
Wihstutz, Anne. 2019. Mittendrin und außen vor – Geflüchtete Kinder und die Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland. In Zwischen Sandkasten und Abschiebung. Zum Alltag junger Kinder in Unterkünften für Geflüchtete, Hrsg. Anne Wihstutz, 45–74. Opladen: Barbara Budrich.
World Vision. 2021. Kinder in der Corona-Krise. Vorabveröffentlichung der 5. World Vision Kinderstudie in Deutschland und Ghana. https://www.worldvision.de/sites/worldvision.de/files/pdf/World_Vision_KinderinderCoronaKrise_final_April2021.pdf. Zugegriffen: 9. Aug. 2022.
Zwingmann, Christian, und Constantin Klein. 2020. Religion and health from the view of psychology of religion: empirical results – possible pathways – cultural context. In Spirituality, mental health, and social support. A community approach, Hrsg. Beate Jakob, Birgit Weyel, 38–55. Berlin: De Gruyter.
Funding
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Additional information
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Rights and permissions
This article is published under an open access license. Please check the 'Copyright Information' section either on this page or in the PDF for details of this license and what re-use is permitted. If your intended use exceeds what is permitted by the license or if you are unable to locate the licence and re-use information, please contact the Rights and Permissions team.
About this article
Cite this article
Rohde-Abuba, C. Religiöse Deutungen der COVID-19-Pandemie aus Sicht von Kindern in Ghana und Deutschland. Z Religion Ges Polit (2025). https://doi.org/10.1007/s41682-025-00204-y
Received:
Revised:
Accepted:
Published:
DOI: https://doi.org/10.1007/s41682-025-00204-y